
Das Prinzip Hoffnung
Seit biblischen Zeiten steht das Pflanzen von Bäumen für das Vertrauen in die Zukunft.

Seit biblischen Zeiten steht das Pflanzen von Bäumen für das Vertrauen in die Zukunft
Der Wochenabschnitt Teruma markiert den Beginn einer ganzen Reihe von Abschnitten, die sich mit dem Bau des Mischkans, des Stiftszelts, und seiner Innenausstattung beschäftigen. Der Ewige sagt zu Mosche, das Volk Israel solle ein bis dahin nicht dagewesenes Gebilde mit genauen Maßangaben und von prachtvoller Schönheit errichten, das als Wohnung für Ihn dienen werde.
Mosche erhält detaillierte Angaben zu Beschaffenheit, Größe und Aussehen. Die Israeliten werden das Stiftszelt nicht nur 40 Jahre in der Wüste mit sich führen, sondern auch nach dem Einzug ins Gelobte Land wird der Mischkan noch einige Jahrhunderte in Gebrauch sein, bis das Volk nach Stationen in Schilo, Mizpa, Givon und Bet Schemesch endlich in Jerusalem ankommt. Und nach seinem Vorbild wird König Schlomo dort eines Tages den Tempel errichten.
AUSSTATTUNG
Im Allerheiligsten des Mischkans befand sich hinter einem Vorhang die Bundeslade. Davor standen die goldene Menora, ein Tisch für die Schaubrote sowie der goldene Altar für das Räucherwerk. Im Hof befand sich der große, mit Kupfer überzogene Altar samt dem kupfernen Becken für die Waschungen. Sie alle sind Einrichtungsgegenstände, die es zuvor in der Geschichte nicht gegeben hat.
Bei der Betrachtung unseres Wochenabschnitts stoßen die Weisen auf eine Ungereimtheit: Die Tora zählt die Einrichtungsgegenstände des Mischkans auf, doch benutzt sie den bestimmten Artikel nicht – außer bei den Brettern. Wenn die Rede auf sie kommt, dann taucht auf einmal der Artikel auf.
Um die Antwort auf diese Ungereimtheit zu finden, muss man untersuchen, welche Bedeutung die Bretter haben. Auf den ersten Blick stellen sie lediglich den Baustoff dar und erscheinen eigentlich recht profan und nebensächlich.
Raschi (1040–1105) erwähnt in seinem Tora-Kommentar zu dieser Stelle einen Midrasch. Laut diesem hat unser Urvater Jakow, als er nach Ägypten kam, dort die Zedern gepflanzt, aus denen später die Bretter für den Mischkan gemacht wurden. Bevor er starb, trug er seinen Nachkommen auf, das Holz der dann ausgewachsenen Zedern beim Auszug aus Ägypten mitzunehmen, denn in der Wüste, auf dem Weg ins Gelobte Land, werde der Ewige ihnen befehlen, das Stiftszelt zu errichten. Für diesen Zweck sollten sie die Bretter bereithalten.
Gerade deshalb, weil der Ewige Mosche genauestens beschreibt, wie der Mischkan auszusehen hat, werden die Bretter mit dem bestimmten Artikel erwähnt, denn es müssen jene Bretter verwendet werden, die Jakows Nachkommen mit sich führen.
TRANSPORT
Doch wozu machen sich die Israeliten so viel Mühe mit diesen Brettern? Es war bestimmt nicht einfach, die sperrigen vier Dutzend Bretter von zehn Ellen Länge und anderthalb Ellen Breite durch das Meer und die Wüste monatelang mit sich zu führen. Hätte man denn an Ort und Stelle keine anderen Bretter beschaffen können, dann, wenn sie gebraucht werden? Das Volk rastete doch in Elim (2. Buch Mose 15,27), wo sich 70 Palmen befanden – die hätte man doch für die Errichtung des Mischkans verwenden können.
Aber auch Jakows Tat ist nicht ganz verständlich. Zu einer Zeit, da er seine Heimat verlassen hat, weil dort eine Hungersnot herrschte, pflanzte er Bäume, die ein paar Jahrhunderte später verwendet werden sollten.
Aus der Überlieferung war es Jakow bekannt, dass seine Nachkommen jahrhundertelang als Sklaven in Ägypten leben werden, ihnen eine lange harte Zeit bevorsteht und mehrere Generationen nur Schmerz, Elend und Folter erfahren werden. In einer solchen Zeit wollte Jakow nicht nur das Versprechen geben, dass der Ewige ganz bestimmt sein Volk in die Freiheit führen wird, sondern es war ihm auch wichtig, etwas zu tun, das seinen Nachkommen die Zeit in der Sklaverei erleichtern würde.
Jakow pflanzt die Zedern als Zeichen der Hoffnung, damit seine Kinder sehen, dass, so wie die Prophezeiung über die Sklaverei in Erfüllung ging, sich gleichermaßen auch die Prophezeiung der Freiheit und des Mischkans erfüllen werden. Jedes Mal, wenn es unerträglich wurde, erblickten die Israeliten die Zedern und fanden darin nicht nur Trost, sondern stärkten sich auch in ihrem Glauben.
Jakow war nicht der Erste, der Bäume als Zeichen der Hoffnung pflanzte. Schon Noach, 13 Generationen vor ihm, hatte aus diesem Grund Zedern gepflanzt.
Der Midrasch Tanchuma (Noach 5) führt eine Meinung von Rabbi Josi an: Der sagte, es habe nur deshalb 120 Jahre gedauert, die Arche zu bauen, weil Noach zunächst die Zedern pflanzte – in der Hoffnung, dass seine Tat die Gesellschaft zur Reue und Rückkehr bewegen würde.
Jeden Tag goss Noach seine Bäume, doch die Menschen lachten ihn aus. Man kann sich schwer vorstellen, 120 Jahre lang Tag für Tag ausgelacht zu werden und trotzdem die Hoffnung auf eine Besserung der Menschen nicht aufzugeben.
SCHOA
Auch heute ist uns das Pflanzen von Bäumen als Zeichen der Hoffnung nicht fremd. Nach der Schoa, als viele sich keine Zukunft mehr vorstellen konnten, dankt der Staat Israel – über die Jerusalemer Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem – jenen Menschen, die ihr Leben aufs Spiel setzten, um Juden zu retten. Dabei wird für jeden »Gerechten unter den Völkern« ein Baum gepflanzt. Bis heute wurden damit mehr als 26.000 Menschen für ihre Verdienste gewürdigt.
Nicht nur diejenigen die die Hölle der Schoa erlebt haben, schöpfen Hoffnung, wenn sie die Bäume in der Allee der Gerechten sehen, sondern auch wir, die dritte und vierte Generation, verlieren bei ihrem Anblick nicht die Hoffnung und den Glauben an die Mitmenschlichkeit.
Golda Meir, die damalige Außenministerin des Staates Israel, sagte beim Festakt zur Eröffnung der Allee der Gerechten: »Die Gerechten unter den Völkern haben nicht nur den Juden das Leben gerettet, sondern auch die Hoffnung und den Glauben an den menschlichen Geist.«
In der heutigen nicht einfachen Zeit, wo sich antisemitische Äußerungen und Übergriffe häufen, braucht es mehr Menschen in unserer Gesellschaft, die sich für das Richtige einsetzen und somit »die Hoffnung und den Glauben an den menschlichen Geist« aufrechterhalten.
Der Autor ist Rabbiner der Jüdischen Kultusgemeinde Groß-Dortmund und Mitglied der Orthodoxen Rabbinerkonferenz Deutschland (ORD). Dieser Artikel erschien in der Jüdischen Allgemeinen.









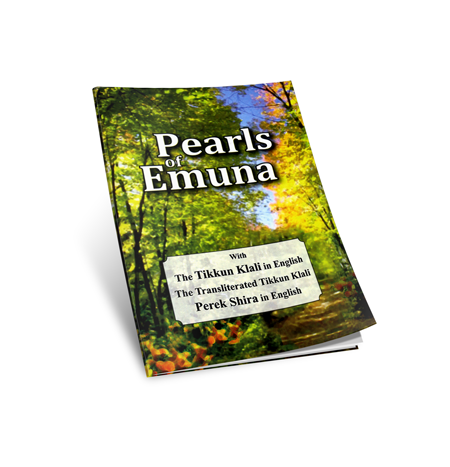
Sagen Sie uns Ihre Meinung!
Danke fuer Ihre Antwort!
Ihr Kommentar wird nach der Genehmigung veroeffentlicht.