
Die Rache des Rabbi
EINE UKRAINISCHE PILGERSTÄTTE IST DIE RACHE DES RABBI

Eine UKRAINISCHE PILGERSTÄTTE ist die Rache des Rabbi
Breslev – Einmal im Jahr wird eine ukrainische Provinzstadt zur Pilgerstätte, Zehntausende Juden aus aller Welt reisen an. Gäste und Bewohner verbindet nichts – außer gegenseitigem Misstrauen.
Die Welt ist wie ein kreisender Würfel, hat der Breslever Rabbi gesagt. Alles dreht sich und kehrt wieder, denn in der Wurzel ist alles eins, und im Wandel liegt die Erlösung beschlossen. Seit er das gesagt hat, sind Kriege hinweggezogen über Bug und Dnjepr, die Gefolgschaft des Rabbis ist erst gewachsen und dann gemordet worden oder geflohen. Aber der Würfel kreist weiter. Jetzt strömen Zehntausende Juden zurück in die Ukraine, denn wer zum Neujahrsfest am Grab des Rabbi Nachman von Breslev betet, den wird er an den Schläfenlocken aus der Hölle ziehen. So hat er es versprochen.
Im Kleinbus von Kiew nach Uman sitzt eine zusammengewürfelte Gruppe von Pilgern. Gleich am Flughafen, wo die Jumbojets der israelischen El-Al standen, hat man sie zu den Bussen geleitet, 40 Dollar für 240 Kilometer. Jetzt zieht vor den Fenstern die dunkle Erde der ukrainischen Ebene vorbei, hin und wieder leuchtet ein weißes Haus unter dem schweren Himmel. Drinnen sprechen sie sich im Chor von den Gelübden des alten Jahres frei. Jossy, Managementdozent aus Paris, sieht nicht aus wie ein Chassid, seine Kippa trägt er unter einer Baseballkappe. Aber in ihm gärt es seit Langem. Einst kannte er von Rabbi Nachman bloß Sprichwörter. "Le désespoir n’existe pas" zum Beispiel, "es gibt keine Verzweiflung". Aber dann ist viel passiert in Jossys Leben, er hat die Schalen des rationalen Denkens abgeworfen und gelernt, sich zu freuen, möglichst immer und überall, wie der Rabbi es lehrt. Letztes Jahr war Jossy zum ersten Mal in Uman, und alles hat sich erfüllt, was er am Grab erbeten hatte. Deshalb lässt er aufs Neue seine schwangere Frau und die zwei Kinder zum Neujahrsfest daheim.
So fruchtbar wie die dunkle Erde beidseits der Straße ist, so fruchtbar war diese Gegend auch für den jüdischen Glauben. Hier entstand im 18. Jahrhundert der Chassidismus, eine religiöse Erneuerungsbewegung, die ekstatisches Gebet und Tanz betonte. Wer seine Seele freimacht, wer das Gute auch im Bösen erkennt, und Gottes Funken in den toten Dingen, der kann sich schon in dieser Welt mit Gott vereinen. So lehrte es Israel Ben Elieser, genannt der Baal Schem Tow, der Meister des Guten Namens.
Breiter Strom von Dollars
Die fromme Bewegung teilte sich sogleich in Gemeinden auf, die jeweils einen Zaddik verehrten, einen besonders frommen Rabbi und dessen Dynastie. So ist es bis heute geblieben, auch wenn der Mittelpunkt chassidischen Lebens längst nicht mehr die Ukraine ist, sondern Jerusalem und New York. Keiner aber hat so viel versprochen wie der Urenkel des Baal Schem Tow, Rabbi Nachman aus Breslev. Er hielt sich für einen einmaligen Zaddik, vielleicht sogar – aber das bestreiten seine Anhänger – für den Messias. Jedenfalls aber traute er sich zu, die Seelen der Lebenden und der Toten zu erlösen. Bevor Rabbi Nachman 1810 starb, schärfte er seinen Schülern ein, Rosch Haschana, den Tag des Gerichts, an seinem Grab zu verbringen. Ausreden ließ er nicht gelten. So begann vor genau 200 Jahren der Pilgerstrom, der jedes Jahr im September oder Anfang Oktober seinen Höhepunkt findet, je nachdem, wie Rosch Haschana, das jüdische Neujahrsfest, fällt.
Freudige Spannung im Bus, als endlich das Ortsschild von Uman mit dem riesigen Kruzifix auftaucht. Aber von der Stadt sieht man wenig. Der Bus quält sich über kleine Schotterpisten zwischen niedrigen Holzhäusern – offenbar ein Versuch, auf dem Weg ins Zentrum den Wegelagerern von der Verkehrspolizei auszuweichen. Ein breiter Strom von Dollars fließt in diesen Tagen zu Rabbi Nachmans Grab, in den möchten viele ihren Krug tauchen. Kaum öffnen sich die Bustüren, werden Schlafplätze angeboten, 150 Dollar pro Kopf, in der Ukraine ist das ein halber Monatslohn. Jugendliche verkaufen ukrainische SIM-Karten, auf die der Telefonanbieter saisonbedingt einen lachenden Juden mit Kippa gedruckt hat. Koffertragen kostet einen Dollar.
Uman ist eine Provinzstadt von 80.000 Einwohnern. Der polnische Adel, der hier zwei Jahrhunderte das Sagen hatte, hat ihr einen zauberhaften Park hinterlassen, die Sowjetunion Plattenbauten und Industrie und zwei Hochschulen. Es gibt einen Leninplatz mit einer von Tannen umzingelten Leninstatue, einen Basar, etwas Provinzbarock und etwas Jugendstil. Es gibt die orthodoxe Nikolai-Kirche, wo gerade zu einer Pilgerreise nach Israel aufgerufen wird (92 Euro, inklusive Bad im Jordan), und am Rand der Stadt einen verlassenen jüdischen Friedhof.
Und dann gibt es die Puschkinstraße. Wie eine verzauberte Brücke im Märchen führt sie aus der ukrainischen Provinz direkt nach Jerusalem. Aber es darf nicht jeder hinüber, die Polizei lässt an Rosch Haschana nur Pilger hinein und Anwohner. Beidseits der Straße stehen neungeschossige sowjetische Wohnbauten mit Reklamen in hebräischer Schrift. Dazwischen drängen sich orthodoxe Juden mit Bärten und Schläfenlocken, mit goldbraun gestreiften Mänteln oder mit schwarzen, mit flachen Pelz-Schtreimeln auf den Köpfen oder Filzhüten oder Kippas, Alte und Junge und Kinder, die mit wehenden Zizim herumlaufen. Und nirgends eine Frau.
Hinten rechts, gleich neben einem hässlichen, neungeschossigen Wohngebäude, ist das Grab von Rabbi Nachman, Zion genannt. Es ist in die Außenwand eines niedrigen Hauses eingelassen. Aber an diesem Abend kann man das nur erahnen, denn über dem Grab wurde eine große Halle errichtet, und die birst vor Menschen und vor Freude. Während ein Vorbeter sich heiser singt, klettern durch die Fenster neue Pilger herein, sogar durch einen Spalt im Dach hangeln sie sich herunter. Manche schlagen rhythmisch gegen die Wand, dass es kracht, und vom Vorraum dringen neue Gesänge in die Halle hinein, und plötzlich verdichtet die Menge sich noch mehr, weil ein Wunder-Rabbi samt Entourage sich hindurchdrückt – Rabbi Yaakov Ifergan ist das, den sie wegen seiner Seherqualitäten den Röntgen-Rabbi nennen. Man würde sich jetzt nicht wundern, wenn geheimnisvolle Zeichen in der Luft erschienen, die Energie der Betenden setzt den ganzen Raum unter Strom. Und dass all dies ausgerechnet hier stattfindet, ist ja tatsächlich ein Wunder. Auf dem großen Gräberfeld der jüdischen Geschichte, das die Ukraine ist, scheinen die Toten auferstanden zu sein, und nun tanzen sie fröhlich durch den Friedhof.
Ukrainer sieht man kaum im Viertel um das Grab. Da sind die Polizisten mit den riesigen Schäferhunden, deren Gekläff sich in den Gesang der Chassiden mischt. Letztes Jahr gab es Konflikte, samt Steinwürfen auf Einheimische, zehn Pilger wurden ausgewiesen. Jetzt wird von Anfang an Präsenz markiert. Und dann sind da die Anwohner der Puschkinstraße, die plötzlich in die Minderheit geraten sind. Man weiß nicht, ob man sie beneiden oder bedauern soll. Als sie zu Sowjetzeiten die neuen Wohntürme bezogen, ahnten sie nicht, was es bedeutet, Rabbi Nachman zum Nachbarn zu haben. Dann starb die Sowjetunion, und die Not war groß, dafür gingen die Grenzen auf, und es kamen die Pilger. Jetzt sind die Wohnungspreise hier auf Berliner Innenstadtniveau hochgeschnellt. Das kleine Gebäude vis-à-vis vom Grab kostet pauschal 12.600 Dollar die Woche, verrät ein erboster israelischer Bauunternehmer, dafür hätte man es in den 1990ern zweimal kaufen können!
Tausende in Synagoge lebendig begraben
Pilger und Anwohner leben in zwei Welten, aber auf engstem Raum, vereint nur durch gegenseitiges Misstrauen. Jossy aus Paris zum Beispiel begegnet seinen Nachbarn, wenn er durchs dunkle Treppenhaus zum Schlafplatz im 9. Geschoss hochsteigt. Der Fahrstuhl wurde abgeschaltet. Es ist unklar, ob des orthodoxen Feiertages wegen oder aus Angst vor Beschädigungen durch die Chassiden. Letzteres vermutet die alte Nachbarin, die sich die Treppe herunterquält. Jossy zahlt 260 Euro für sein klappriges Bett, es ist eines von sechs im Zimmer. Wasser gibt es keins. "Das haben sie uns Juden extra abgestellt", sagt Jossys Zimmergenosse düster. "Nein", sagt die Nachbarin, "das kommt bloß nicht in die oberen Etagen. Die Leitungen sind alt."
Vor Haus Nr. 44 in der Puschkinstraße arbeiten drei Männer in leuchtend gelben Jacken mit der Aufschrift "Breslov World Center" in Hebräisch und Englisch. Sie sammeln den Müll auf, der hier überall in Bergen herumliegt. Für die Chassiden ist es Sünde, weil Arbeit, ihn aufzuheben. Die Müllmänner arbeiten für zehn Hrywnia (ein Euro) die Stunde. "Billigarbeit", sagt Alexander. Er kriegt sonst noch von der Tschernobyl-Havarie eine kleine Rente, und außerdem vermietet er seine Wohnung für 100 Dollar pro Schlafplatz. Rosch Haschana heißt für ihn, in der Garage zu leben. "Wir mögen die Chassiden nicht", sagt er, "aber in Israel sind die ja auch unbeliebt. Hier müsste mal ein Stalin oder Hitler für Ordnung sorgen." "Nein", sagt sein Helfer. "Nicht ein Stalin oder Hitler – ein Honta!"
Iwan Honta ist in Uman eine bekannte Figur. Er gilt als Held des ukrainischen Freiheitskampfes gegen die polnische Feudalherrschaft. Unter seiner Führung eroberten die aufständischen Hajdamaken 1768 die Festung. Dann massakrierten sie alle Juden. Tausende wurden in der Synagoge lebendig begraben, in den Straßen verstümmelt, niedergeritten, aufgespießt, vergewaltigt. Das Umaner Blutbad ging in die jüdische Geschichte ein, und die Stadt wurde dafür bestraft oder belohnt mit den Pilgermassen. Denn der Bratzlawer Rabbi zog nach Uman, um sich neben den Opfern von 1768 begraben zu lassen. Er wollte sie aus seinem Grab heraus erlösen.
Ein Hajdamake mit Spieß schmückt bis heute das Wappen der Stadt. Außerdem markiert ein Stein die Stelle, wo Honta und seinem Mitstreiter Zalisnjak ein Denkmal errichtet werden soll. Es wurde nie gebaut. Am Sonntag haben sie an diesem Stein für ein "Uman ohne Chassiden" demonstriert. 60 Teilnehmer, das waren fast alle, wurden sofort festgenommen. Aufgerufen hatte die kleine rechtsradikale Swoboda-Partei. In ihrem ärmlichen Hauptquartier hängt das Feindbild an der Wand: Ein selbstgemalter Alien mit Kippa und Schläfenlocken, eingerahmt von einem Verbotsschild. Das Problem, sagen die Swoboda-Leute, beginnt ja erst nach Rosch Haschana. Wenn der Feiertag geendet hat, belästigen die Pilger hier die Mädels. Man hätte nichts dagegen, wenn Rabbi Nachmans Überreste nach Israel gebracht würden, "auch wenn wir das nie gefordert haben". In den Köpfen der Veranstalter ist Gut und Böse recht einfach verteilt. War das nicht mal eine jüdische Stadt, mit mehr Synagogen als Kirchen? "Das sind aber nicht unsere Juden! Das sind andere." Wurden denn die Umaner Juden nicht im Holocaust ermordet? "Wir haben unseren eigenen Holocaust!" Gemeint ist der Hungertod ukrainischer Bauern unter Stalin.
Planlose Ausschreitungen gegen die Juden
1941 marschierte die Wehrmacht nach einer Kesselschlacht in Uman ein. Am Rande der Stadt hielt man Zehntausende Rotarmisten in einem Hungerlager, während ein Einsatzkommando der SS sich daran machte, die Juden zu ermorden. Im Bericht an Himmler beschwerte sich die SS über den Enthusiasmus ukrainischer Hilfspolizisten. Zusammen mit Wehrmachtssoldaten hätten sie einfach so drauflos geplündert. "Durch die planlosen Ausschreitungen gegen die Juden in Uman hat die Systematik der Aktion des Einsatzkommandos 5 naturgemäß außerordentlich gelitten." So hätten zunächst nur 1 412 Juden ermordet werden können. Das war am 22. und 23. September 1941, dem 1. und 2. Tischri nach jüdischem Kalender, an Rosch Haschana. Mindestens weitere 6000 Juden starben in der Folge.
"Ohne die vielen, vielen ukrainischen Helfer hätten die Deutschen die Juden gar nicht töten können", sagt bitter der Umaner Jude Karl Epstein am Telefon. Er ist 81 Jahre alt und hat als Kind den Holocaust überlebt. Solche wie ihn gibt es nur noch ein paar Dutzend in Uman. "Bald ist Uman judenfrei", scherzt er auf deutsch. Und die Chassidim, die hierherpilgern? "Mit denen hab ich nichts zu tun", sagt Epstein. "Da ist viel Gesindel drunter. Ist meine subjektive Meinung."
Nelja Nagornaja ist Konservatorin im Heimatmuseum von Uman. Dort steht ein Modell des Honta-Denkmals, das nie gebaut wurde. "Wir Ukrainer waren immer tolerant", sagt sie. Nach dem Krieg kehrten viele geflohene Juden zurück, sie ist mit jüdischen Klassenkameraden aufgewachsen, die jetzt in Israel leben. Man blieb befreundet, sagt sie. Ganz anders die Pilger, von denen seien viele feindlich gesinnt. Einmal haben sie ihr und ihren Nachbarn auf russisch zugerufen: Wir werfen Euch in den Graben! So wie einst die toten Juden in den Graben geworfen wurden. Frau Nagornaja hat eine Wohnung am Grab, die vermietet sie jedes Jahr an dieselben Pilger – nicht israelische Chassidim, sondern französische Juden. Feine Leute, mit denen gibt es keine Schwierigkeiten, sagt sie. Überhaupt ist die Aggression etwas Neues. Erst seit drei Jahren ist das so. "Vorher kamen bloß Alte", sagt Frau Nagornaja, "jetzt kommen viele Junge, und besonders religiös wirkten die auf mich nicht, ehrlich gesagt."
Wenig fromm ist zum Beispiel Ariel, der am frühen Morgen des ersten Festtages am Rand des Grabes sitzt und unter seinem dünnen Gebetsschal friert. Es ist über Nacht bitterkalt geworden, kein Vergleich mit den Strandtemperaturen in Tel Aviv. Im Vorhof stehen sephardische Juden und wärmen sich mit heftigem Gebet. Manche tragen die dicken Kälte-Overalls der israelischen Armee. In seinen kräftigen Handwerker-Händen hält Ariel ein Gebetsbuch – das falsche, wie er gerade festgestellt hat, es ist für Werktage gedacht. Ariel kennt sich da nicht aus. Er ist ein säkularer linker Israeli, aufgewachsen in New York, 26 Jahre alt und ohne Kinder, "thank God". Tagsüber betreibt er eine Autowerkstatt, die Nächte verbringt er in den Clubs von Tel Aviv. "Von dort kommst Du direkt in die Hölle", sagt er, und es klingt wie ein Empfehlung. Das Fest an Rabbi Nachmans Grab, das ja in gewisser Weise auch eine Party ist, ist für ihn ein Experiment. Viele haben ihm abgeraten. Die beste Freundin fürchtete, Ariel werde zwangsbekehrt. Die fesseln dich an einen Stuhl und hypnotisieren dich, sagte sie.
"Die sind doch alle verrückt hier"
Jetzt feiern alle um ihn herum, und er fühlt sich ausgeschlossen. "Die sind doch alle verrückt hier", sagt Ariel, und betrunken seien viele noch dazu. Sonst würden die da drin nicht so wild tanzen und von den Wänden springen. "Und ich sitze hier und bin 100 Prozent nüchtern." Er hat die Pilger für sich in vier Gruppen eingeteilt. Neben den wirklich Frommen gibt es die Pseudo-Frommen, die nur so tun als ob, die Möchtegern-Frommen, die auf der Suche sind, und die Nicht-Religiösen. Die Grenze zwischen fromm und unfromm ist offenbar schwer zu ziehen, sie geht mitten durchs Leben hindurch und durch die Menschen, sonst wäre ja auch Ariel nicht hier. Oder es wären nicht die jungen Männer hier mit den weißen Zipfel-Kippas, auf denen das kabbalistische Mantra Na-Nach-Nachma-Nachman zu lesen ist, ein Spiel mit Rabbi Nachmans Nachnamen. In Israel kennt man sie dafür, dass sie mit gewaltigen Lautsprecheranlagen durch die Straßen fahren und zu chassidischer Techno-Musik tanzen.
Zu den Neuerungen in Uman gehören auch die taghell angestrahlten Essenszelte in der Puschkinstraße. Uman hatte bisher schon eine der größten Synagogen Europas – obere Etage für Aschkenasim, untere für Sephardim -, ein großes Ritualbad, zwei Zeltstädte für die armen Pilger aus Israel. Nun hat der Ort auch noch eine Kantine mit 8000 Sitzplätzen, wo in drei Schichten gegessen wird, und auch nachts noch die Schlangen stehen.
Die Kantine ist Tzvi Bogomilsky zu verdanken. Er steht im Küchenzelt neben einem Regal mit Lachsscheiben und wartet, dass das Mittagsgebet fertig gesprochen ist, oder: fertig getutet. Einer bläst ins Schofar-Horn, ein Helfer hält ihm das Gebetbuch hin und blättert um. Es klingt wie eine Morsebotschaft für den Herrn. Im Hintergrund arbeiten ukrainische Küchenkräfte mit rosa Nummern auf der Brust. Bogomilski trägt eine feuerrote Koch-Jacke mit der Aufschrift "Executive Chef" und "Uman 5772". In den Täschchen auf der Brust stecken statt Bratenthermometern zwei Davidoff-Zigarren.
Bogomilsky betreibt eine Kette von Altenheimen in Miami/Florida, aber er fährt seit neun Jahren nach Uman, um aus eigener Tasche die Massen zu speisen. In der Küche wird in drei Schichten gekocht, nach Regeln, die das Kochen nicht gerade leicht machen: Feiertags darf Bogomilsky den Herd nicht einschalten, nur die Flamme anpassen. Wenn Freitagabend Rosch Haschana endet und der Sabbat beginnt, darf er nicht mal mehr das. Heute gab es Kartoffel-Kugel und Gulasch, sephardisch gewürzt. Mit Fleisch aus den Staaten und Gemüse aus der Ukraine.
Männer beten vor geschlossener Ladeklappe, drinnen ein Toter
Bogomilsky zeigt stolz, was er geschaffen hat. Drei Hektar Land hat er hier erworben für 1,7 Millionen Dollar, er hat Bäume gefällt und Gebäude abgerissen, eine Straße gesperrt und eine neue gebaut. Das gab böses Blut unter den Anwohnern. Aber die Welt, wie Tzvi Bogomilsky sie sieht, besteht nicht aus Problemen, sondern aus Versuchen, diese Probleme zu überwinden. Das ist eine sehr amerikanische Sicht. "Die Ukrainern denken weniger praktisch", sagt er.
Seine Führung endet dort, wo lauter Ukrainerinnen Kartoffeln schneiden. Gleich daneben steht ein Kühl-Laster, es beten Männer vor der geschlossenen Ladeklappe. Drinnen liegt ein Toter. Es ist ein Chasside, der am Vortag beim Baden gestorben ist. Es passierte kurz vor der Taschlich-Zeremonie, als alle sich am Wasser versammelten, um die Sünden des alten Jahres hineinzuschütteln. Ein düsterer Himmel hatte über dem See gelegen, und dann war ein Wolkenbruch niedergegangen in die tanzende Menge.
"Bei uns regnet es ja immer an Rosch Haschana", sagt die Sekretärin des Vize-Bürgermeisters." Das ist, weil die Chassiden Gott um Regen bitten", behauptet sie. Aus den Fenstern geht der Blick auf den regennassen Lenin. So wie es im Rathaus aussieht, scheint von dem Geld, das Rabbi Nachman anzieht, wenig in der Stadt hängenzubleiben. Dafür kommt derzeit ein ukrainischer Fernsehkanal nach dem anderen, um Vizebürgermeister Pjotr Pajewski zu interviewen. Er ist für die organisatorischen Fragen des Neujahrsfestes zuständig. Sicher gibt es Probleme, sagt er, den Müll zum Beispiel – 17 Tonnen sammeln wir an normalen Tagen, 33 Tonnen zu Rosch Haschana. Einige Pilger benehmen sich schlecht, da muss die Polizei durchgreifen. Und die Vermieter sollten bitte ihren Hausrat versichern. Aber es ist alles eine Frage der großen Zahl.
26.038 von ihnen sind da, fast 1500 mehr als letztes Jahr. Und das sind nur die offiziell als Gäste gemeldeten.
Keine historischen Angaben, nur Vermutungen
1988 fing die Pilgerei so richtig an, erinnert sich Pajewski, da kamen 200 Chassiden. Vorher war Uman wie viele sowjetische Städte gesperrt für Ausländer. Dass allerdings die Stadt an Nachmans Grab einen jüdischen Friedhof überbaut habe, wie die Chassiden sagen, streitet er ab. Das sei kein Friedhof, offiziell jedenfalls nicht.
Aber ist es dann sicher, dass Rabbi Nachmans Grab überhaupt dort liegt? Viele Umaner bezweifeln das. Was denkt Pajewski selbst? Er sucht nach Worten. Das ist eine heikle Frage, man kann mit der Antwort viel kaputtmachen. Es ist, als würde man den Bürgermeister von Lourdes fragen, ob er selbst glaubt, dass die Madonna in seinem Ort erschienen sei. "Es gibt keine historischen Angaben, dass das Grab genau dort liegt. Aber es gibt eine solche Vermutung, und wir schließen uns ihr an", sagt er.
Am Sonnabend liegt herrlicher Sonnenschein über der Stadt. Rosch Haschana ist zu Ende, dafür hat ein anderer Feiertag begonnen: der Tag der Stadt Uman. In Reih und Glied ziehen Werktätige und Studenten durch die Straße, Betrieb für Betrieb, Fakultät für Fakultät. Es ist ein heiteres, biederes, sowjetisch-gottfernes Fest. Es feiert, was an Rabbi Nachmans Grab verboten ist, die Arbeit. Die Stadt findet wieder zu sich selbst, und bald werden auch die Pilger heimkehren zu ihren Frauen, und Tzvi Bogomilsky wird seine Küche schließen, und der See, in den die Sünden so vieler Jahre versenkt wurden, wird wieder still daliegen und auf ein neues Rosch Haschana warten.
Quelle: Berliner Zeitung






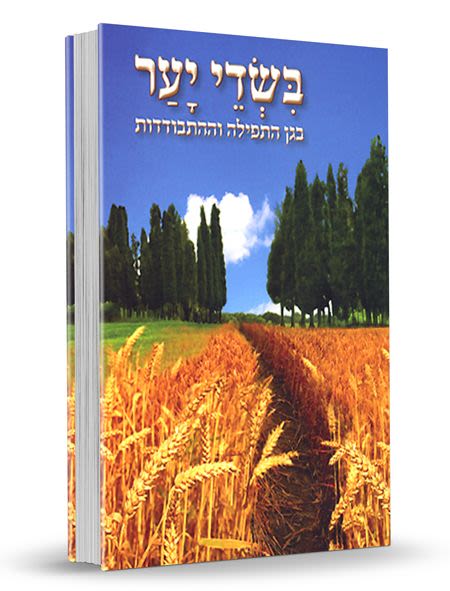


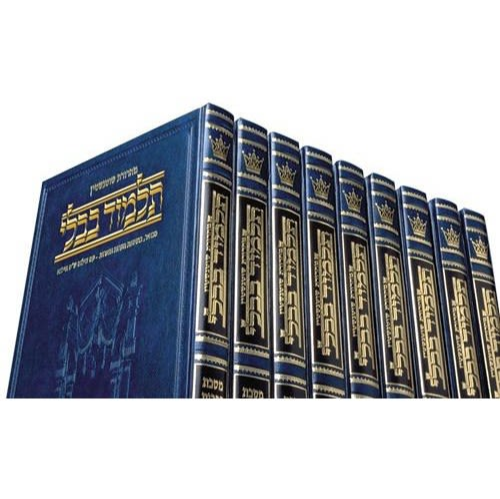

Sagen Sie uns Ihre Meinung!
Danke fuer Ihre Antwort!
Ihr Kommentar wird nach der Genehmigung veroeffentlicht.