
Das erste Gebot
Ein Moralgesetz, das seine umfassende und zeitlose Wirkung der Tatsache verdankt, dass es von G’tt offenbart wurde und nicht menschlicher Kreativität entstammt.

Warum der Beginn des Zehnworts den Weg zur Dankbarkeit gegenüber G’tt weist.
»Ich bin der Herr, dein G’tt, der dich aus dem Lande Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhause« (2. Buch Mose 20,2). Mit diesen Worten beginnt eine universelle Werteordnung, die unabhängig von gesellschaftlichen Stimmungen und politischen Entwicklungen einen eindeutigen ethischen Rahmen festlegt.
Ein Moralgesetz, das seine umfassende und zeitlose Wirkung der Tatsache verdankt, dass es von G’tt offenbart wurde und nicht menschlicher Kreativität entstammt. Ein Kodex, der uns mit wenigen simplen Vorschriften den Weg in eine bessere Welt ebnen soll.
Bei genauerem Hinsehen ist die Sache allerdings alles andere als simpel. Vor allem stellt sich gleich zu Beginn die Frage, ob es sich bei dem ersten sogenannten Gebot überhaupt um ein Gebot handelt.
Denn Christen und Juden zählen die Zehn Gebote unterschiedlich. Während Christen davon ausgehen, dass der erste Satz nur eine Präambel, also eine Einleitung, darstellt, begreifen Juden diesen bereits als ein erstes, eigenständiges und elementares Gebot.
Obwohl diese Sichtweise bereits im Talmud ihren Ausdruck fand, wurde die Frage auch von unseren Weisen lange Zeit unterschiedlich beantwortet, bis sich die heutige Ansicht schließlich durchgesetzt hat.
ASSERET HADWARIM
Dabei spricht der hebräische Originaltext überhaupt nicht von Geboten. Dort ist stattdessen von den »Asseret HaDwarim«, also den zehn Verlautbarungen oder Äußerungen die Rede. Eine solche Verlautbarung kann ein Gebot beinhalten oder auch zwei oder auch drei. Sie muss es aber nicht notwendigerweise. Allein deswegen schon ist die Frage mit Blick auf den Originaltext gar nicht ohne Weiteres zu beantworten.
Dennoch gab es durchaus Kontroversen über den Inhalt und den Charakter der jeweiligen Verlautbarungen, während die grundsätzliche und überragende Bedeutung der zehn Äußerungen nie in Abrede gestellt worden ist.
Eine umfassende Diskussion entspann sich deshalb nicht nur um die Frage, ob der Satz »Ich bin der Herr, dein G’tt« überhaupt ein Gebot beinhaltet, sondern auch darum, was wohl der Inhalt dieses Gebots sein könne.
Maimonides (1135–1204), der wohl bedeutendste jüdische Gelehrte und Philosoph, betrachtete den ersten Satz als das erste, als das grundlegendste Gebot überhaupt und außerdem als Basis des Glaubens an G’tt.
DEBATTE
Nachmanides (1194–1270) hingegen erwiderte wenige Jahrzehnte später, der Glaube sei zweifellos eine Grundvoraussetzung des Verhältnisses zwischen Mensch und G’tt. Gleichzeitig aber spreche schon der Wortlaut der ersten Verlautbarung gegen den Gebotscharakter. Stattdessen handele es sich um ein Faktum und nicht um eine Vorschrift mit verbindlichem Inhalt.
Der spanisch-jüdische Gelehrte Hasdai Crescas (1340–1410) meinte dazu, dass ein Zirkelschluss vorläge, wenn man davon ausgehen wolle, dass der Ewige einem befehlen könne, an ihn selbst zu glauben. Denn entweder glaube man nicht an G’tt. Dann helfe auch kein Gebot. Oder man glaube eben doch an den Ewigen. Dann aber bedürfe es keines ausdrücklichen Gebotes mehr. Ein g’ttliches Gebot, an G’tt zu glauben, sei deshalb schlicht unlogisch.
Der jüdische Philosoph Isaak Abrabanel hingegen konkretisierte die Idee von Maimonides im 15. Jahrhundert und erklärte, dass es nicht darum gehe, den Glauben an G’tt einzufordern, sondern sich dem Ewigen durch das Studium, das Nachforschen und durch philosophisches Denken zu nähern.
Schließlich löste der Malbim (Rabbiner Meir Löw), ein angesehener Torakommentator des 19. Jahrhunderts, den vermeintlichen Widerspruch in Maimonides’ Logik auf. Diesem sei es nicht darum gegangen, aus der ersten Verlautbarung ein Gebot des Glaubens an G’tt herauszulesen. Stattdessen sei es ihm um Kenntnis und Wissen der Existenz und des Wesens des Ewigen gegangen.
Hier reiche der simple, einfache und unkultivierte Glaube nicht mehr aus. Vielmehr bedürfe es eines komplexeren Verständnisses, eines umfassenderen Wissens und eines geschulten und anspruchsvollen Verstandes, um das Wesen und die Existenz G’ttes begreifen zu können.
Der Talmud und die herrschende Meinung gehen deshalb davon aus, dass wir es hier mit einem eigenständigen und fundamentalen Gebot zu tun haben, welches uns neben der Anerkennung des Ewigen die Erlangung eines umfassenden Wissens um G’tt abverlangt.
EXODUS
Damit sind wir allerdings noch lange nicht am Ende. Denn der erste Satz der zehn Äußerungen hat noch viel mehr zu bieten: So stellten schon unsere Weisen die Frage, weswegen G’tt als derjenige beschrieben wird, der die ehemaligen Sklaven aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, und nicht als derjenige, der die Welt erschaffen hat. Wäre es nicht wesentlich eindrucksvoller gewesen, wenn sich G’tt als Schöpfer des Universums, der Welt und allen Lebens vorgestellt hätte?
Ja und nein. Zwar mag die Weltschöpfung das imposantere Ereignis gewesen sein, doch der Auszug aus Ägypten war dafür das unmittelbarere. Kein einziger der Menschen, die am Berg Sinai versammelt waren und die g’ttliche Offenbarung erlebt haben, hat die Weltschöpfung persönlich miterleben oder bezeugen können. Aber jeder Einzelne, von klein bis groß, hat die Plagen in Ägypten beobachtet und die Wunder erlebt. Jeder Einzelne hat das g’ttliche Eingreifen und die Fürsorge für die Geknechteten am eigenen Leib erfahren.
Es ging also einerseits um die Glaubwürdigkeit G’ttes. Dem anwesenden Volk, das Hunderte von Jahren in einer polytheistischen, heidnischen Kultur verbracht hatte, musste nochmals in aller Deutlichkeit vor Augen geführt werden, dass dieser sich nun offenbarende G’tt derselbe war, der sie aus der Knechtschaft befreit hatte. Der G’tt ihrer Väter. Der Ewige und Einzige.
Andererseits war es eine Botschaft, welche in jeder Generation nachhallt. Durch diese Selbstbeschreibung macht der Ewige unmissverständlich klar, dass er ein persönlicher G’tt ist, der sich um die Belange seiner Geschöpfe kümmert.
Es ist der krasse Gegenentwurf zu der G’ttesvorstellung des griechischen Philosophen Aristoteles. Dieser nahm zwar an, dass es einen sogenannten »unbewegten Beweger« gegeben haben müsse, der am Anfang aller Dinge stand. Gleichzeitig verwarf er allerdings die Vorstellung, dass der Schöpferg’tt in der Lage gewesen wäre, mit seiner Schöpfung in Verbindung zu treten.
Es ist also die demonstrative Zurückweisung theistischer Vorstellungen, die zwar einen Schöpfer annehmen, jedoch nicht daran glauben, dass dieser sich auch nur im Entferntesten um das Schicksal seiner Schöpfung schert.
ANTEIL
Der G’tt der Hebräischen Bibel dagegen ist vollkommen anders. Er ist persönlich erfahrbar, er nimmt Anteil und er sorgt sich um die Menschen. Und das betont er hier ein für alle Mal.
In diesem Zusammenhang weisen die Rabbiner darauf hin, dass gleich das erste Wort, das im hebräischen Originaltext verwendet wird, überraschenderweise gar kein hebräisches Wort ist, sondern ein ägyptisches! Warum, so fragen sie, benutzt der Schöpfer ein ägyptisches Wort, um sich vorzustellen?
Der Grund ist folgender: G’tt nutzt während seiner Vorstellung und zu Beginn seines monumentalen Kodex ebenjene Sprache, an die die Kinder Israels durch ihren langen Zwangsaufenthalt in Ägypten gewöhnt waren. Es ist sein Weg, um eine Annäherung zwischen den ehemaligen Sklaven und ihm selbst zu erleichtern. Er beginnt mit einem ihnen bekannten Wort, um auch sprachlich eine Vertrauensbasis zu schaffen.
Doch warum begnügt er sich nicht damit, den Menschen mitzuteilen, dass er sie aus Ägypten geführt hat? Weshalb betont er in einem Halbsatz, dass es sich um ein Sklavenhaus gehandelt habe? Als ob diejenigen, die gerade aus der Jahrhunderte währenden Knechtschaft befreit worden waren, dies nicht selbst gewusst hätten!
G’tt tat es, weil er den Menschen nur zu gut kennt und deshalb weiß, wie schnell Dankbarkeit verblasst. Wie schnell man das Gute vergisst, das einem zuteilgeworden ist, und stattdessen das Schlechte betont. Und gleichzeitig: Wie leicht man seine gegenwärtige Situation beklagt, während Erinnerungen an dunkle geschichtliche Perioden beschönigt und romantisiert werden.
FLEISCHTÖPFE
G’tt jedenfalls weiß, wovon er spricht. Denn nur kurze Zeit nach der Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei begann das Volk zu klagen. Weil es kein Wasser gab, weil es kein Essen gab, weil in Ägypten alles besser war. Und obwohl der Ewige die Kinder Israels während der langen Zeit in der Wüste mit Nahrung versorgte, nörgelten sie doch wie unzufriedene Kinder und sehnten sich in verklärter Erinnerung nach den sprichwörtlichen »Fleischtöpfen Ägyptens«.
Bei einer nüchternen Betrachtung der Realität und einem ungeschminkten Blick auf die Vergangenheit hätten die Israeliten eigentlich vor Dankbarkeit und Glücksgefühl platzen müssen. Doch der Mensch ist nun einmal so, wie er ist. Und Dankbarkeit ist eine Empfindung, die meist zu schnell vergeht, wenn sie nicht beständig gehegt und gepflegt wird.
Eben deshalb bedurfte es der ausdrücklichen Erwähnung gerade im ersten Gebot. In der frommen Hoffnung, dass wir alle irgendwann verstehen, dass Dankbarkeit der wahre Schlüssel zu persönlichem Glück ist. Und wer, wenn nicht der glückliche Mensch, macht die Welt wohl zu einem besseren Ort?
Der Autor ist Direktor des Landesverbands der Jüdischen Gemeinden in Hessen. Dieser Artikel erschien in der Jüdischen Allgemeinen.








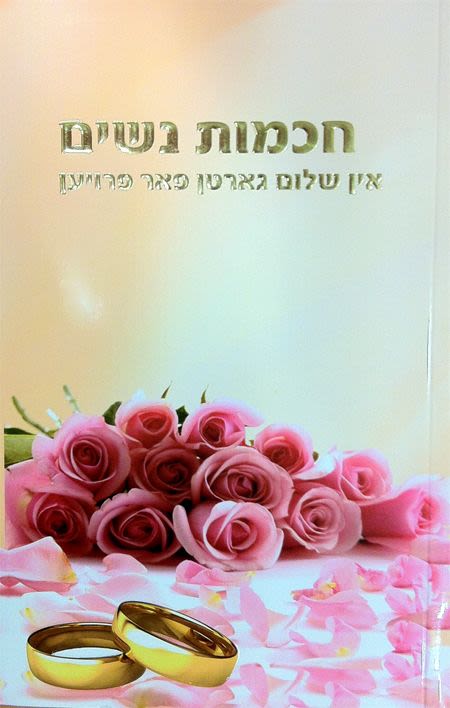

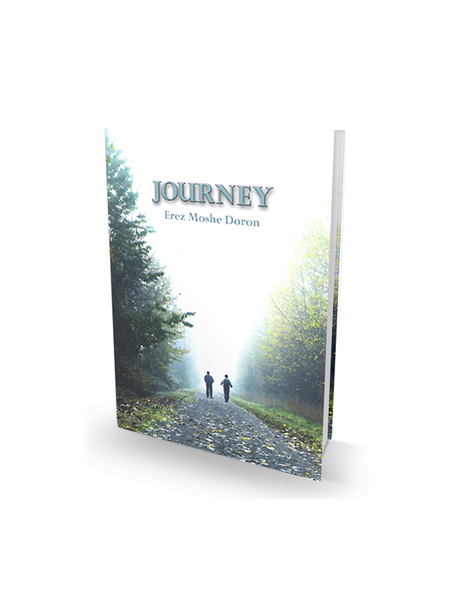
Sagen Sie uns Ihre Meinung!
Danke fuer Ihre Antwort!
Ihr Kommentar wird nach der Genehmigung veroeffentlicht.