
Wunder
Einbruch ins kalte Wasser: Wer durch ein Wunder einer großen Gefahr entgangen ist, soll eine Bracha sagen.

Einbruch ins kalte Wasser: Wer durch ein Wunder (hebräisch: Nes) einer großen Gefahr entgangen ist, soll eine Bracha sagen.
Die Rabbinen haben eine Bracha, einen Segensspruch, formuliert, der beim Wiedersehen eines Ortes zu sprechen ist, an dem man durch ein Wunder (hebräisch: Nes) einer großen Gefahr entgangen ist: »Gelobt seist Du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, Der mir an diesem Ort ein Wunder erwiesen hat.« Im Schulchan Aruch (Orach Chajim 218,4) steht geschrieben, dass auch Nachkommen der geretteten Person die Bracha sagen sollen – natürlich in einer entsprechend abgewandelten Form, zum Beispiel »der meiner Mutter an diesem Ort ein Wunder erwiesen hat«.
Im Talmud (Berachot 54a) wird die Frage aufgeworfen, was unsere Weisen veranlasst habe, diesen Segensspruch einzuführen. Als Quelle nennt Rabbi Jochanan folgenden Toravers: »Und Jitro sprach: Gepriesen sei der Ewige, Der euch gerettet aus der Hand Mizrajims und aus der Hand des Pharaos, Der das Volk gerettet aus der Gewalt Mizrajims« (2. Buch Mose 18,10). Als Mosches Schwiegervater Jitro von den Wundern beim Auszug aus Ägypten erfuhr, pries er den Ewigen. Seine Bracha diente nach Rabbi Jochanan als Vorbild.
Wer den hebräischen Wortlaut der hier behandelten Bracha sucht, wird ihn in den meisten Gebetsbüchern finden, so im Siddur Sefat Emet und im Hirsch-Siddur.
NATURGESETZE
Wie ist das in der Bracha genannte Wunder zu bestimmen? Rabbiner Josef Karo (1488–1575) weist in seinem Schulchan Aruch (Orach Chajim 218,9) auf eine diesbezügliche Meinungsverschiedenheit der Gelehrten hin. Die einen sprechen nur dann von einem Wunder, wenn die Naturgesetze eindeutig außer Kraft gesetzt worden sind. Andere akzeptieren auch ein sehr unwahrscheinliches Geschehen als Wunder, wenn zum Beispiel jemand einem gefährlichen Räuber entkommen ist. Rabbiner Karo empfiehlt, bei einem Wunder der schwächeren Art die Bracha ohne Erwähnung von G’ttes Namen und Seinem Königtum zu sprechen.
Dass die Wunder-Bracha in der Responsenliteratur oft diskutiert wurde, dürfte niemanden überraschen. Azgad Gold erwähnt in seiner auf Hebräisch verfassten Studie Über Wunder und Natur (Ramat Gan 2014) eine Reihe halachischer Gutachten zu diesem Thema. So referiert er ein Responsum von Rabbiner Bezalel Stern (1910–1989) zu der Frage, ob KZ-Überlebende bei einem späteren Besuch dieses Ortes die Wunder-Bracha sprechen sollen. Rabbiner Stern begründet ausführlich, warum diese Frage zu bejahen ist. Daraus ergibt sich übrigens, dass auch Kinder von Auschwitz-Überlebenden bei einem Besuch des ehemaligen Lagers den Segensspruch sagen sollten.
Die Tatsache, dass Dezisoren (hebräisch: Poskim) eine bestimmte Situation, die vielleicht als ein Wunder anzusehen ist, unterschiedlich bewerten können, macht Gold an folgendem Beispiel deutlich: Ein Mann, der beim Überqueren eines zugefrorenen Flusses ins eiskalte Wasser einbrach und nur mit großer Mühe gerettet wurde, fragte drei Poskim, ob er verpflichtet sei, beim Anblick jener Flussstelle die Wunder-Bracha zu sprechen. Rabbiner Menasche Klein (1924–2011) antwortete, der Gerettete solle sie nicht sagen; Rabbiner Nathan Gestetner (1932–2010) hingegen empfahl, er möge den Segensspruch ohne Erwähnung von G’ttes Namen und Seines Königtums sagen; Rabbiner Schmuel HaLewi Wosner (1913–2015) entschied, der Fragesteller solle die ungekürzte Bracha sagen.
Was der aus dem Eisloch gerettete Jude dann gemacht hat, wissen wir nicht. Aber dieser Fall macht uns klar, warum es verboten ist, eine praxisrelevante halachische Frage an mehrere Poskim zu richten. Man kann dann in eine Zwickmühle geraten.
Mit einem Segensspruch am Ort des Wunders hat man übrigens seine Pflicht noch nicht ganz erfüllt. Im Kizzur Schulchan Aruch (61,3) von Rabbiner Schlomo Ganzfried (1804–1886) heißt es: »Wem ein Wunder geschehen ist, der soll seinem Vermögen entsprechend Geld für wohltätige Zwecke absondern und an solche Menschen verteilen, die Tora lernen. Er spreche: ›Ich gebe dieses Geld zur Wohltätigkeit, möge es wohlgefällig vor Dir sein, dass es mir angerechnet werde, als hätte ich ein Dankopfer gebracht‹. Es ist gut und würdig für ihn, irgendetwas, was die Gemeinde benötigt, in der Stadt einzurichten. Und in jedem Jahr an diesem Tag sondere er sich eine Weile ab, um dem Ewigen zu danken und das Wunder zu erzählen.«
Der Autor ist Psychologe und hat an der Universität Köln gelehrt. Dieser Artikel erschien in der Jüdischen Allgemeinen.









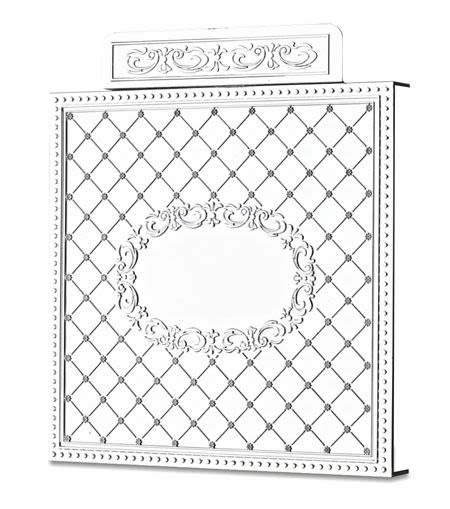

Sagen Sie uns Ihre Meinung!
Danke fuer Ihre Antwort!
Ihr Kommentar wird nach der Genehmigung veroeffentlicht.